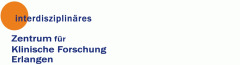Laufende ELAN Projekte
ELAN-Anschubfinanzierung
Die Anschubfinanzierung (ELAN) dient der Förderung von Projekten des wissenschaftlichen Nachwuchses aus der gesamten Medizinischen Fakultät als Anschub-, Pilot- und/ oder Zwischenfinanzierung.
Projekte:
Projektleitung:
Überlebenszunahme bei jungen Krebserkrankten lässt Fertilitätserhalt relevanter werden. Ovarkryokonservierung mit posttherapeutischer Retransplantation ist eine Methode, die aber bei manchen Krebsarten ein Rezidivrisiko birgt. Eine vielversprechende Alternative: das künstliche Ovar, da nur die Follikel entnommen werden. Überleben, Reifung und Wachstum von Follikeln in 3D-Gerüsten soll in live-cell-Bildgebung unter Verwendung eines Spinning-Disk konfokalen Mikroskops versucht werden darzustellen.
Projektleitung:
T-Zellen wandern in das zentrale Nervensystem (ZNS) ein und beeinflussen es. Wir zeigen eine massive T-Zell-Migration in ein erkranktes ZNS durch noch unbekannte Mechanismen. Hier werden T-Zell-anziehende Mechanismen des neurodegenerativen ZNS und T-Zell-getriebene neurodegenerative Mechanismen in einem Stammzellbasierenden 3D-ZNS-Modell mit RNA-Sequenzierung und biochemisch untersucht. Erkenntnisse werden zeigen, wie die Migration von T-Zellen durch das neurodegenerative ZNS angeregt wird.
Projektleitung:
Mithilfe von fortgeschrittenen Deep-Learning-Techniken basierend auf synthetischen Trainingsdaten werden MRT-Rekonstruktionsverfahren für die quantitative Suszeptibilitätskartierung (QSM) entworfen, welche für anatomische Regionen außerhalb des Gehirns optimiert werden. Die neuronalen Netzwerke werden für verschiedene Parameter, wie z.B. die magnetische Feldstärke, verallgemeinert und in der Prostata, im Knie und in der Brust an Probanden getestet und gegen konventionelle Methoden verglichen.
Projektleitung:
Osteoklasten (OCs) spielen eine Schlüsselrolle bei der Regulierung der Knochenmasse, und eine übermäßige Osteoklastogenese ist an der Gelenkzerstörung bei Autoimmunarthritis oder Osteoporose beteiligt. Das derzeitige Wissen über den Zellstoffwechsel und seinen Einfluss auf die OC-Funktion und auf den Knochen bleibt unklar. In diesem Projekt zielen wir darauf ab, die metabolische Dynamik während der Osteoklastogenese zu charakterisieren und neue Regulatoren des Knochenumsatzes zu identifizieren.
Projektleitung:
Unsere Vorabstudie zeigte protektive Effekte von 3-Indolpropionsäure (IPA) auf den Schweregrad der CIA-Arthritis bei Mäusen. Unser Projekt soll nun I) Einblicke in allgemeine IPA-Effekte auf die Gehirnfunktion in Ruhe gewinnen und II) mittels (Thermo-) fMRT die zentrale Nozizeption als einen funktionellen Parameter für den Schweregrad der RA evaluieren. III) wird untersucht, ob eine Langzeitbehandlung mit IPA zusätzlichen Nutzen für den Krankheitsverlauf haben kann.
Projektleitung:
Parodontitis (PA) ist eine hoch prävalente Erkrankung., welche in bidirektionaler Verbindung zu Diabetes und Alzheimer steht und zur Zerstörung zahntragender Gewebe führt. Die Pathogenese der PA ist unzureichend verstanden. Es soll untersucht werden, ob eine Dysbalance von Th17/Treg besteht, wie die Assoziation mit pro- und antiinflammatorischen Zytokinen ist und ob Veränderungen lokal oder systemisch sind. Ziel ist die Identifikation von Biomarkern und Ansatzpunkten für eine Immuntherapie.
Projektleitung:
Trotz guter Ansprechrate gibt es bei der Behandlung des Melanoms auch hohe Resistenzraten unter Immun- und zielgerichteter Therapie. Es bedarf daher neuer Therapieoptionen und wir benötigen Testsysteme, die eine Vorhersage des Behandlungsansprechen ermöglichen. 3D-Organoide können hierbei ein aussichtsreiches Modell sein. In diesem Projekt werden aus Melanomen gewonnene Organoide als Testplattform kultiviert, um in vitro das Ansprechverhalten von Tumortherapien in vivo vorhersagen zu können.
Projektleitung:
Um disseminierte Tumorzellen (DCCs) im Lymphknoten (LK) von NSCLC-Patienten als Prognoseparameter weiter zu validieren und Detektionsprotokolle zu vereinheitlichen, werden Immunzytologie und Ultrastaging verglichen und Möglichkeiten untersucht, um Zellen für eine molekulare Analyse zu gewinnen. Morphologie, DCC-Density und Ploidie werden korreliert. Die prognostische Bedeutung der Morphologie von LK-Metastasen wird untersucht. Zudem wird die Rolle von DCCs im neo-adjuvanten Setting beleuchtet.
Projektleitung:
Wir konnten im Darm von RA Patienten höhere Prevotella-Konzentrationen feststellen. Unser Ziel ist es, die Mechanismen zu definieren, die das Auftreten von Arthritis durch P. int. in einem Mausmodell erhöhen. Wir stellen die Hypothese auf, dass die äußeren Membranvesikel von P. int. die Epithelbarriere stören, was zu einer Verringerung der IL-18-Spiegel führt. Diese Störung ermöglicht es DCs eine entscheidende Rolle bei der Auslösung von Th17-Zell-vermittelter Arthritis in Mäusen zu spielen.
Projektleitung:
Körperliche Aktivität bei Fontan-Patienten wirkt sich positiv auf die Herz-Kapazität aus. Die maximale Sauerstoffaufnahme stellt den besten Prädiktor für Morbidität und Mortalität hier dar. Es kann durch Bewegung verbessert werden. Hochintensives Intervalltraining (HIIT) isst die beste Möglichkeit. Ein App-basiertes Training, das über Fitness-Tracker überwacht werden kann, ermöglicht ein positives Feedback sowohl an das Kind als auch die Familie und kann zu einem aktiveren Lebensstil anregen.
Projektleitung:
Das beantragte Projekt beschäftigt sich zum einen mit der Frage über welche Mechanismen das extrazelluäre Matrixprotein Nephronektin (NPNT) aus Podozyten sezerniert wird. Der Export von NPNT soll u.a. über Hemmung von Exozytose und lysosomalen Transportwegen untersucht werden. Zum anderen sollen Interaktionspartner von NPNT innerhalb der Integrin-Familie, welche auf Podozyten exprimiert werden, identifiziert und die Qualität dieser Interaktionen in vitro als auch in vivo näher analysiert werden.
Projektleitung:
In diesem Projekt wird vergleichend der Effekt des Humanen T-Zell-Leukämie Virus (HTLV-1) auf dendritische Zellen (DZ) in zwei Modellen betrachtet. Die Übertragung von HTLV-1 auf DZ über eine intestinale Barriere steht hier im Fokus, wobei der Phänotyp von DZ und die Art der Übertragung analysiert werden. Dafür wird ein 2D Transwell und eine 3D organs-on-a-chip Modell verwendet. Im Anschluss werden beide Modelle in ihren Vor- und Nachteilen und der Effekt auf den Phänotyp von DZ verglichen.
Projektleitung:
Mutationen im CTBP1 verursachen das seltene Syndrom HADDTS. Ich habe gezeigt, dass CTBP1 den Energiestoffwechsel im Hippocampus kontrolliert und die synaptische Übertragung vor metabolischem Stress schützt. Die Deletion hatte in Glia und/oder Neuronen unterschiedliche Effekte. Wir werden die Rolle von CTBP1 in der metabolischen Kopplung zwischen Neuronen und Glia untersuchen, die für die Homöostase im Gehirn notwendig ist. Die Ergebnisse liefern eine neue Grundlage für die Behandlung von HADDTS.
Projektleitung:
Im Brustkrebs hängt der Erfolg neoadjuvanter Chemotherapie von tumorinfiltrierenden Lymphozyten und ihrer Spezifität, besonders gegen Neoantigene als potentielle Immuntherapie-Targets, ab. 3D Zellkulturen bieten eine realistischere Darstellung der Tumor-Immunzellinteraktion als herkömmliche Kulturen. Hier sollen vier T-Zell-Rezeptor-basierte Zelltherapien gegen Neoantigene in 2- und 3D-Modellen vergleichen werden, um den vielversprechendsten Ansatz für künftige Behandlungen zu identifizieren.
Projektleitung:
Nanopartikeln, die mit einer RGD Sequenz funktionalisiert wurden, um an podozytäre ?V?3 Integrinrezeptoren zu binden, und die mit therapeutischen Substanzen beladen sind, sollen als Podozyten spezifische Therapiestrategie fungieren. Aufnahme und therapeutisches Potential der Partikel, einen proteinurischen Phänotyp zu mindern, werden in verschiedenen Zebrafischmodellen untersucht. Die Experimente ermöglichen eine Analyse von Nanopartikeln zur zelltypspezifische Arzneimittelverabreicherung.
Projektleitung:
Ziel des geplanten Projekts ist es, die Wirkung der NPWT auf die an der Wundheilung beteiligten Zelllinien und auf die allgemein in der Haut vorkommenden Zellen zu untersuchen. Keratinozyten, Melanozyten, Fibroblasten, Endothelzellen und ADSCs werden in Kombination mit NPWT unter dynamischen Bedingungen (kontinuierlicher Mediumfluss über eine Peristaltikpumpe) kultiviert. Unter optimalen Kultivierungsbedingungen werden die Auswirkungen einer verlängerten Anwendung von NPWT untersucht.
Projektleitung:
Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung von Lipid-Nanopartikel (LNP)-Impfstoffen zur zielgerichteten Verabreichung von HIV-1-Antigenen und mRNA, die Checkpoint-Inhibitoren (CPI) kodiert. Durch die Präsentation von HIV-1-Antigenen auf der LNP-Oberfläche sollen Env-spezifische B-Zellen effizient adressiert und aktiviert werden. Die gleichzeitige Abgabe von CPI-mRNA in die Zellen soll eine lokale Produktion von CPI induzieren und so die Immunantwort ohne systemische CPI-Gabe modulieren.
Projektleitung:
Chronischer Stress hat lang anhaltende Auswirkungen auf die Funktion des Hippocampus, aber es ist unklar, wie. Wir untersuchen stressinduzierte epigenetische Veränderungen als Bindeglied zwischen Stress und Hirnfunktionsstörungen. Unsere vorläufigen Daten haben gezeigt, dass chronischer Stress den epigenetischen Faktor Lamin B1 beeinflusst, der Heterochromatin aufrechterhält. Wir werden untersuchen, wie Stress Lamin B1 reduziert und wie sich dies auf die epigenetische Regulierung auswirkt.
Projektleitung:
Gangstörungen als häufiges und alltagsrelevantes Symptom der Parkinson-Krankheit können durch digitale Technologien in und außerhalb der Klinik objektiv und quantitativ erfasst werden. In diesem Projekt werden digitale Mobilitätsdaten aus einer großen multizentrischen Studie umfassend analysiert, um objektive Endpunkte zur Beschreibung des Krankheitsverlaufs (Fortschreiten der Krankheit / Ansprechen auf Therapie) bei Parkinson-Patienten (n=130) zu ermitteln. Alle Datensätze sind verfügbar.
Projektleitung:
HCMV-Glykoprotein B-Varianten werden hinsichtlich viraler Fusion & Syncytienbildung untersucht. Die spezifischen Ziele sind: (1) Identifizierung von Polymorphismen, die die Fusion steigern oder hemmen; (2) Charakterisierung des Fusionsphänotyps dieser Viren in verschiedenen Zelllinien; und (3) Entwicklung eines murinen CMV mit hyperfusogenem gB. Diese Studie zielt darauf ab, die Regulation der gB-Fusion zu verstehen & potenzielle diagnostische Marker für die HCMV-Pathogenität zu identifizieren.
Projektleitung:
Projektleitung:
Bei einer Subgruppe von Patienten mit Post-COVID Syndrom (PCS) treten funktionelle Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren (GPCR-fAAbs) auf. Bei diesen Patienten möchten wir Änderungen des Immunzellkompartments charakterisieren, nachdem wir in Vorversuchen bereits Veränderungen bestimmter Immunzellen beobachten konnten. Weiterhin möchten wir in ex-vivo und in-vitro Versuchen den Effekt des Wirkstoffes BC 007, welcher GPCR-fAAbs neutralisieren kann, auf Immunzellen untersuchen.
Projektleitung:
Das Ziel dieses Projekts ist es, den Einfluss von T-Zellen und des NLRP3-Inflammasoms im Zusammenhang mit der Atrophie des multiplen Systems (MSA) besser zu verstehen. Dazu werden ein bereits etabliertes transgenes Mausmodell und menschliches Hirngewebe von MSA-Patienten verwendet. Ziel ist es, den Grundstein für weitere Projekte zu legen, die T-Zellen und NLRP3 als potenzielle pharmakologische Ziele für die Behandlung von MSA nutzen.
Projektleitung:
Auf Grund einer unspezifischen Hemmung beeinflussen Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) auch den Knochen- und Knorpelstoffwechsel. Kinder- und Jugendliche leiden daher unter der Therapie an deutlichen Wachstumsverzögerungen. Alternative Therapiekonzepte werden daher dringend benötigt. Im beantragten Projekt sollen die Einflüsse verschiedener TKIs auf den Knochenmetabolismus und die Knorpeldifferenzierung untersucht werden.
Projektleitung:
Projektleitung: